|
|
|
Nicolai Gedda: Eine Jahrhunderstimme
Es war 1952, als Walter Legge, der mächtigste Plattenproduzent der Nachkriegsjahrzehnte, nach seinem Vorsingen in Stochholm an Herbert von Karajan und an den Intendanten der Mailänder Scala, Antonio Ghiringelli, telegrafierte: „Hörte gerade den größten Mozart-Sänger meines Lebens: Sein Name ist Nicolai Gedda.“
Der junge Mann, der an der Stochholmer Oper
gerade als „Postillon von Lonjumeau“ sein fulminantes Bühnendebüt
gegeben hatte, wurde sofort engagiert als Grigori in „Boris Godunow“ für
die (inzwischen legendäre) Plattenaufnahme Issay Dobrowens. Gedda
wurde zu einer der sängerischen Säulen künftiger EMI-Produktionen
und zu einem der gefragtesten Tenöre der folgenden Jahrzehnte auf
allen großen Opernbühnen der alten und neuen Welt. Zwar machte
er seine internationale Blitzkarriere nicht als Mozarttenor, aber eine
andere Prophezeiung Legges, die Nicolai Gedda in seiner Autobiographie
überliefert, bewahrheitete sich: „In ein paar Jahren wird die ganze
Musikwelt von Ihnen sprechen.“
Der Sechsundzwanzigjährige war nicht
nur auf der Stelle von einem der wichtigsten Plattenproduzenten exklusiv
unter Vertrag genommen worden, er erhielt sofort einen Vorsingtermin an
der Mailänder Scala, wo er 1953 debütierte. Ein Jahr später
sang er im Wiener Musikverein den Don José in einer konzertanten
„Carmen“, an Covent Garden den Herzog im „Rigoletto“, an der Pariser Opéra
den Hüon in Webers „Oberon“ und den Tamino in der „Zauberflöte“.
Das Festival in Aix-en-Provence rief ihn. Bereits 1957 sang er an der New
Yorker Met den (französischen) Faust, den (italienischen) Ottavio
und den (amerikanischen) Anatol in der Uraufführung von Samuel Barbers
„Vanessa“. Die Salzburger Festspiele engagierten ihn als Belmonte in der
„Entführung“ und als Horaz in der Uraufführung von Liebermanns
„Schule der Frauen“.
Nicolai Gedda war nicht nur, was man im
heutigen Musikmanagement einen „shooting-star“ nennt, er war der stilistisch
wie sprachlich vielseitigste Sänger seiner Generation. Und ein enorm
fleißiger Künstler auf der Bühne wie im Konzertsaal und
im Plattenstudio. Seine Diskographie ist die wohl umfangreichste, die es
von einem Tenor überhaupt gibt. An die hundert Gesamtaufnahmen hat
er eingespielt, darunter eine Fülle bis heute unübertroffener
Referenzaufnahmen vor allem im französischen Fach, für das sich
seine Stimme ideal eignete. Wer nach 1945 sang Meyerbeer oder Berlioz so
idiomatisch, so elegant, so kultiviert wie Gedda? Auch sein Rossini-Gesang
setzte Maßstäbe. Allein der Reichtum der Trouvaillen und Raritäten
unter Geddas Aufnahmen übersteigt bei weitem die Repertoire-Hitliste
Pavarottis, Carreras‘ und Domingos. Gedda war ein Tenor der Extraklasse,
ein Ausnahmesänger, der die für heutige Verhältnisse ungeheuerliche
Eigenschaften besaß, die „voix mixte“ optimal einzusetzen, die Register
seiner Stimme bruchlos verblenden zu können und vorbildlich zu deklamieren.
Darüber hinaus verfügte er über eine geradezu Staunen machende
stilistische wie sprachliche Einfühlungsgabe ins Französische
nicht nur, sondern auch ins Russische, Schwedische und Deutsche. Seine
biographisch bedingte Mehrsprachigkeit kam ihm dabei zugute. Um den italienischen
Verismo hat er wohlweislich einen Bogen gemacht, ebenso wie um das allzu
Dramatische und Heldenfach. Er wollte den lyrischen Glanz seines makellos
strömenden, hellen und hohen Tenors nicht gefährden. Eines der
Geheimnisse seiner langen und erfolgreichen Gesangskunst war gewiß
der sichere Instinkt und das Wissen um die Grenzen seiner Stimme. Die warme
Sinnlichkeit des Südens zum Beispiel fehlte ihr, sonnige Italianità
und Erotik. Geddas Singen hatte und hat stets etwas Keusches, Silbriges,
Kühles, gepaart allerdings mit Anmut, Leichtigkeit und atemberaubender
technischer Virtuosität. Der Stimmumfang Geddas war allerdings außergewöhnlich,
die Tragfähigkeit seiner präsenten, sehr resonanten Stimme hervorragend.
Allen schlimmen, gefürchteten Tenorgefährdungen und –untugenden
(mit denen manche heutigen Tenöre schamlos und ohne künstlerisches
Gewissen dennoch Karriere machen) hatte Gedda bis ins hohe Alter widerstanden.
Er hat nie forciert, seine Stimme hat den „richtigen“ Sitz, sie ist frei
von Versteifungen, Verengungen, Tremolos oder sonstigen Abnutzungserscheinungen.
Noch seine Liederabende der letzten Jahre (immerhin eines über siebzigjährigen
Sängers) bestachen durch jugendlichen Klang, Geschmeidigkeit und technische
Präzision der Stimmführung. Es darf sich glücklich schätzen,
wer einen dieser raren Liederabende hören konnte.
Immer waren aristokratische Eleganz, perfekte
Idiomatik, nuancierteste sprachliche Gestaltung, enorme Stilsicherheit
und makellose Phrasierung unschlagbare Qualitätskennzeichen von Geddas
Vortrag. Er hat Vorbildcharakter! 1990 gab er mit der Partie des Hoffmann
in „Hoffmanns Erzählungen“ an der Wiener Staatsoper seinen offiziellen
Abschied von der Opernbühne. Erfreulicherweise gestattet er sich immer
wieder Rückfälle. Liederabende gedenkt er so lange fortzusetzen,
wie es seine Stimme erlaubt und er das Publikum zu begeistern vermag. Die
standing ovations, die ihm Jung und Alt auf seinen raren Liederabenden
noch der jüngsten Vergangenheit darboten, sprechen für sich.
Es ist zu hoffen, daß er nicht nur
zum Plaisir der Nostalgiker und Stimmfetischisten, sondern als lebendiges
Exempel für das nachwachsende Publikum, aber auch für jüngere
Sängergenerationen zum Vorbild noch einige Jahre als hörbare,
erlebbare Legende einer leider aussterbenden, hohen tenoralen Gesangskultur
auftreten wird.
Wer das singuläre Phänomen Nicolai
Gedda, die Vita und die künstlerische Karriere des Sängers näher
kennenlernen will, der wird die (auf Tonbandprotokollen seiner Frau basierende,
1977 erstmals auf Schwedisch veröffentlichte) aus schlichtem Empfinden
und Formulieren entstandene Autobiographie Nicolai Geddas als Schlüssel
zu seiner Gesangskunst zu nutzen wissen. Sie erhebt keinerlei hochtrabende
intellektuelle Ansprüche. Es ist die aufrichtige Dokumentation einer
warmherzigen, fragilen, romantischen, zu Melancholie neigenden, introspektiven
Künstlerpersönlichkeit. Wie ein roter Faden sieht sich das Trauma
der Ungewißheit seiner Herkunft durch den Lebensbericht Geddas, der
mit einer rätselhaften, hin- und hergeworfenen Kindheit und Jugend
beginnt. Die sympathische Schüchternheit und sich selbst schützende
Distanziertheit, ja Introvertiertheit des Menschen Nicolai Gedda mögen
darin wurzeln. Ganz sicher aber auch die eiserne Disziplin seiner Gesangskultur
und vor allem jener spezifisch keusche Klang seiner Jahrhundertstimme,
die so einzigartig wie unverwechselbar ist.
| Berlin, August 1988 | Dieter David Scholz |
| entnommen aus: | 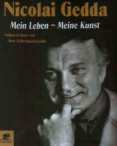 |
Gedda, Nicolai:
Mein Leben - Meine Kunst Aufgezeichnet von Aino Sellermark-Gedda Berlin: Parthas Verlag GmbH, 1998 ISBN 3-932529-22-7 |